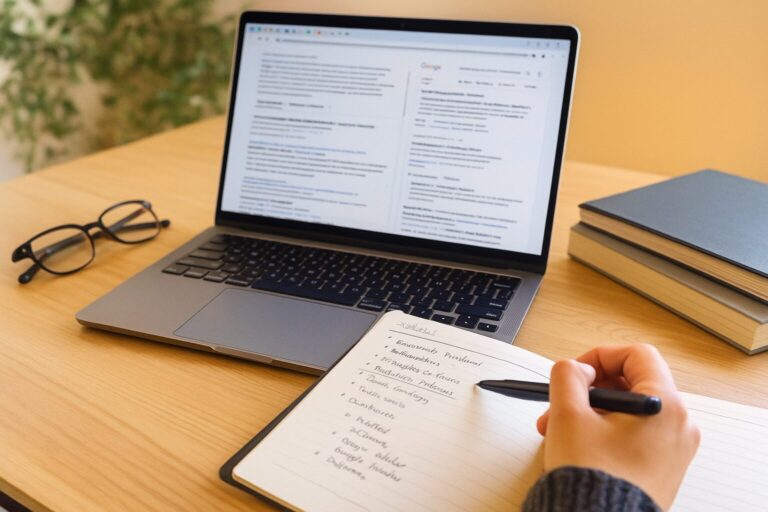Eine systematische Literaturrecherche bildet das Fundament jeder wissenschaftlichen Arbeit. Sie sorgt für Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Qualität in der Forschung. Wer wissenschaftlich arbeiten möchte, muss wissen, wie relevante Quellen gezielt gefunden, bewertet und dokumentiert werden. Bei BuchInsider zeigen wir, wie Sie Schritt für Schritt eine systematische Literaturrecherche aufbauen, welche Methoden und Datenbanken geeignet sind, und worauf es bei der Auswertung wissenschaftlicher Literatur wirklich ankommt.
Was ist eine systematische Literaturrecherche?
Die systematische Literaturrecherche ist eine strukturierte, methodisch nachvollziehbare Suche nach wissenschaftlichen Informationen zu einem bestimmten Forschungsthema. Im Gegensatz zur unsystematischen oder narrativen Recherche folgt sie klar definierten Regeln und Kriterien. Ziel ist es, alle relevanten wissenschaftlichen Studien oder Publikationen zu einem Thema zu identifizieren, kritisch zu bewerten und zusammenzuführen.
Sie stellt sicher, dass keine wichtigen Erkenntnisse übersehen werden, und ermöglicht es, die Forschung auf einer soliden Basis aufzubauen. Besonders in empirischen Arbeiten, systematischen Reviews oder Abschlussarbeiten ist diese Form der Recherche unverzichtbar.
Warum ist eine systematische Literaturrecherche so wichtig?
Eine gute Forschung basiert auf vorhandener Evidenz. Nur wer den aktuellen Stand der Wissenschaft kennt, kann fundierte Hypothesen entwickeln und Forschungslücken identifizieren.
Die systematische Literaturrecherche:
- schafft Transparenz in der Forschungsarbeit,
- reduziert Verzerrungen (Bias),
- fördert Reproduzierbarkeit,
- ermöglicht strukturierte Synthese vorhandener Erkenntnisse.
Kurz gesagt: Sie ist der Unterschied zwischen einer gut begründeten Arbeit und einer rein subjektiven Auswahl von Quellen.
Der Ablauf einer systematischen Literaturrecherche
1. Formulierung der Forschungsfrage
Am Beginn jeder Recherche steht die präzise Definition der Forschungsfrage. Sie bestimmt, welche Informationen gesucht werden und welche Suchbegriffe relevant sind.
Bewährt hat sich die Verwendung von Frameworks wie:
- PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) – häufig in medizinischen Studien
- SPIDER (Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, Research type) – für qualitative Forschung
- PEO (Population, Exposure, Outcome) – für beobachtende Studien
Beispiel: „Wie beeinflusst Bewegung die mentale Gesundheit von Studierenden?“
Hieraus lassen sich erste Suchbegriffe und Synonyme ableiten, etwa „Sport“, „Bewegung“, „psychisches Wohlbefinden“, „Studierende“, „Mental Health“ etc.
2. Planung und Auswahl der Datenbanken
Die Wahl der Datenbanken ist entscheidend für die Qualität der Ergebnisse. Eine umfassende Recherche nutzt mehrere Quellen, da keine Datenbank alle Publikationen abdeckt.
Wichtige wissenschaftliche Datenbanken:
- PubMed / Medline: Medizin und Gesundheitswissenschaften
- PsycINFO: Psychologie und Sozialwissenschaften
- ERIC: Pädagogik und Bildungsforschung
- Scopus / Web of Science: Multidisziplinär, große Abdeckung
- BASE, Google Scholar: Ergänzende akademische Suchmaschinen
- EconLit, JSTOR, Business Source Premier: Wirtschaft und Management
Wir empfehlen, mindestens zwei fachspezifische und eine multidisziplinäre Datenbank zu nutzen, um ein breites Spektrum abzudecken.
3. Entwicklung der Suchstrategie
Die Suchstrategie legt fest, welche Begriffe, Synonyme und Operatoren verwendet werden. Dabei kommen boolesche Operatoren zum Einsatz:
- AND: verknüpft Begriffe (Beispiel: „Sport AND Depression“)
- OR: erweitert die Suche (Beispiel: „Depression OR Angst“)
- NOT: schließt Begriffe aus (Beispiel: „Sport NOT Fußball“)
Zusätzlich sind Trunkierungen und Phrasensuchen hilfreich, etwa:
- „child*“ findet „child“, „children“ usw.
- „mental health“ sucht exakt nach dieser Wortkombination.
Die Suchstrategie sollte dokumentiert werden. Inklusive der genutzten Begriffe, Operatoren und Datenbanken.
4. Durchführung der Recherche
Die eigentliche Suche erfolgt systematisch anhand des vorher festgelegten Protokolls. Dabei sollten folgende Punkte beachtet werden:
- Ergebnisse regelmäßig speichern oder exportieren
- Filter nach Publikationsjahr, Sprache oder Dokumenttyp nur mit Bedacht einsetzen
- Relevante Quellen mit Literaturverwaltungsprogrammen wie Citavi, Zotero oder EndNote erfassen
Ein Rechercheprotokoll hilft, alle Schritte transparent festzuhalten – von der Datenbankauswahl bis zur letzten Suchanfrage.
5. Auswahl und Bewertung der Literatur
Nach der Recherche folgt die Screening-Phase. Sie besteht meist aus zwei Schritten:
- Titel- und Abstract-Screening: Ausschluss offensichtlich irrelevanter Treffer
- Volltextanalyse: Bewertung der verbleibenden Studien nach festgelegten Kriterien
Einschlusskriterien können z. B. Studienart, Untersuchungszeitraum, Stichprobengröße oder Qualität der Methodik sein.
Ausschlusskriterien definieren, welche Studien nicht berücksichtigt werden – etwa Fallberichte, nicht-peer-reviewte Quellen oder ältere Arbeiten.
Zur Bewertung der Qualität wissenschaftlicher Studien werden häufig Checklisten wie die PRISMA-Guidelines, CASP oder AMSTAR eingesetzt.
6. Datenextraktion und Synthese
Im Anschluss an die Bewertung erfolgt die Datenextraktion: Relevante Informationen wie Autor, Jahr, Studiendesign, Ergebnisse und Limitationen werden in Tabellen oder Softwaretools dokumentiert.
Wie unterscheiden sich systematische und narrative Literaturrecherche?
Während eine narrative Recherche eher explorativ und subjektiv erfolgt, ist die systematische Recherche methodisch streng und reproduzierbar.
Wesentliche Unterschiede:
| Merkmal | Systematische Literaturrecherche | Narrative Literaturrecherche |
| Ziel | Vollständigkeit und Objektivität | Überblick und Interpretation |
| Vorgehen | Strukturiert, mit Protokoll | Frei, je nach Thema |
| Quellenbewertung | Nach festen Kriterien | Nach Relevanzempfinden |
| Transparenz | Hoch | Geringer |
| Einsatzgebiet | Wissenschaftliche Arbeiten, Reviews | Essays, theoretische Arbeiten |
Für Abschlussarbeiten, wissenschaftliche Artikel und evidenzbasierte Studien ist die systematische Recherche der Goldstandard.
Hilfreiche Tools und Software
Um die Effizienz zu erhöhen und Fehler zu vermeiden, nutzen viele Forschende digitale Werkzeuge:
- Citavi, EndNote, Zotero: Literaturverwaltung und Zitation
- Rayyan: Unterstützung beim Screening-Prozess
- Covidence: Tool für systematische Reviews
- Excel / SPSS / MAXQDA: Datenextraktion und Analyse
Diese Tools sparen Zeit und erleichtern die Nachvollziehbarkeit. Ein entscheidender Faktor für wissenschaftliche Qualität.
Typische Fehler bei der systematischen Literaturrecherche
Viele Forschende machen ähnliche Fehler, die die Qualität der Arbeit beeinträchtigen.
Dazu gehören:
- Zu unscharf formulierte Forschungsfragen
- Nutzung von nur einer Datenbank
- Fehlende Dokumentation der Suchstrategie
- Unzureichende Bewertung der Quellenqualität
- Selektive Auswahl von Studien nach gewünschtem Ergebnis
Diese Fehler lassen sich vermeiden, wenn die Recherche planvoll und dokumentiert durchgeführt wird.
Tipps für eine erfolgreiche systematische Literaturrecherche
- Planen Sie ausreichend Zeit ein – Recherche und Screening können Wochen dauern.
- Definieren Sie klare Einschluss- und Ausschlusskriterien.
- Verwenden Sie Synonyme und verschiedene Schreibweisen in der Suche.
- Dokumentieren Sie jede Suchanfrage vollständig.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Aktualität der Quellen.
Systematische Literaturrecherche in der Praxis: Beispiel und Ablaufplan
Ein konkretes Beispiel verdeutlicht den Ablauf:
Forschungsfrage: „Wie wirkt sich Homeoffice auf die Produktivität von Mitarbeitenden aus?“
Ablaufplan:
- Begriffe festlegen: „Homeoffice“, „Remote Work“, „Produktivität“
- Boolesche Operatoren kombinieren: („Remote Work“ OR „Telecommuting“) AND „Productivity“
- Datenbanken: Scopus, Web of Science, Business Source Premier
- Treffer prüfen, irrelevante Studien ausschließen
- Qualitätsbewertung mit CASP-Checkliste
- Ergebnisse tabellarisch erfassen und zusammenfassen
Fazit: Struktur führt zu Qualität
Eine systematische Literaturrecherche ist mehr als eine Informationssuche – sie ist das Rückgrat wissenschaftlicher Arbeit. Durch ein methodisches Vorgehen, transparente Dokumentation und kritische Bewertung der Quellen entsteht ein belastbares Fundament für jede Forschung.
Wer die hier beschriebenen Schritte konsequent umsetzt, vermeidet typische Fehler, erhöht die wissenschaftliche Qualität und legt den Grundstein für belastbare, nachvollziehbare Ergebnisse.
FAQ zur systematischen Literaturrecherche
Wie lange dauert eine systematische Literaturrecherche?
Je nach Thema und Umfang kann sie zwischen zwei Wochen und mehreren Monaten dauern. Besonders das Screening und die Qualitätsbewertung nehmen viel Zeit in Anspruch.
Welche Software unterstützt mich bei der Literaturverwaltung?
Programme wie Citavi, Zotero oder EndNote helfen beim Speichern, Zitieren und Organisieren von Quellen.
Muss jede Bachelorarbeit eine systematische Literaturrecherche enthalten?
Nicht zwingend. Sie ist vor allem bei wissenschaftlichen Arbeiten mit analytischem oder evidenzbasiertem Anspruch erforderlich.
Wie oft sollte man Suchbegriffe aktualisieren?
Bei längeren Projekten empfiehlt sich eine erneute Suche vor der Abgabe, um neue Publikationen einzuschließen.
Was ist der Unterschied zwischen systematischer und integrativer Literaturrecherche?
Während die systematische Recherche auf Vollständigkeit zielt, integriert die integrative Recherche auch theoretische und empirische Arbeiten zu einem Thema, um ein umfassendes Verständnis zu schaffen.
Passende Artikel:
Künstlernamen eintragen lassen – Leitfaden für Autorinnen und Autoren
Interview transkribieren – Der ultimative Ratgeber für präzise und effiziente Transkriptionen
Rezension schreiben: Aufbau, Tipps und Beispiele für überzeugende Bewertungen
Pseudonym: Bedeutung, Anwendung und rechtliche Grundlagen
Bildquellen angeben – rechtssicher und professionell visualisieren
Wichtiger Hinweis: Die Inhalte dieses Magazins dienen ausschließlich Informations- und Unterhaltungszwecken und besitzen keinen Beratercharakter. Die bereitgestellten Informationen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Eine Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit wird nicht übernommen, jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Inhalte ist ausgeschlossen. Diese Inhalte ersetzen keine professionelle juristische, medizinische oder finanzielle Beratung. Bei spezifischen Fragen oder besonderen Umständen sollte stets ein entsprechender Fachexperte hinzugezogen werden. Texte können mithilfe von KI-Systemen erstellt oder unterstützt worden sein.